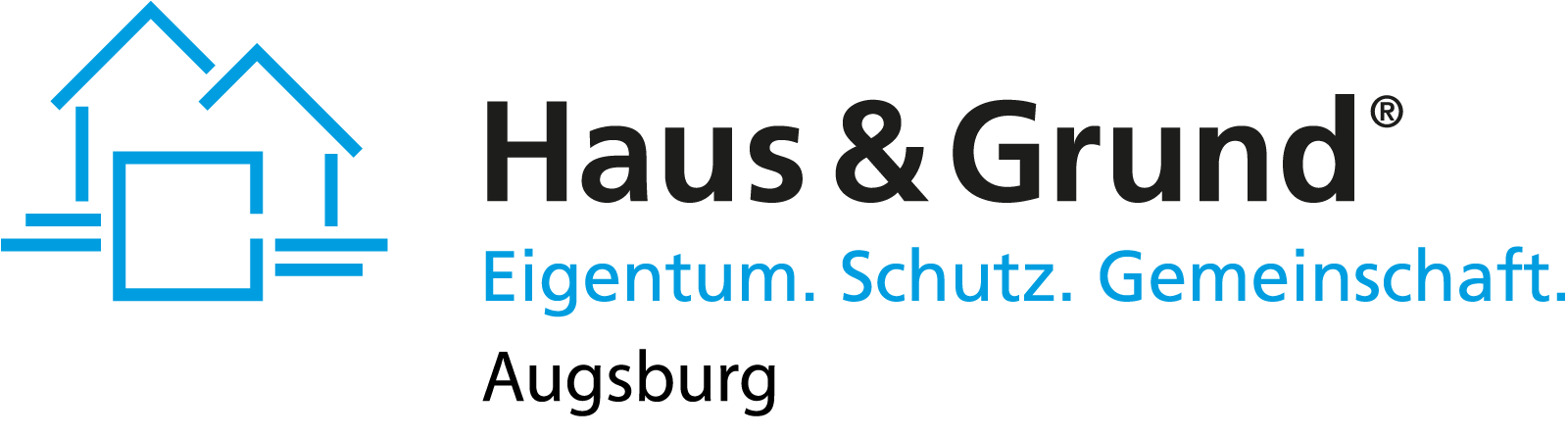


Baurecht
„Angebot“ und Handwerkerrechnung
Schlicht der „Klassiker“: Hauseigentümer H beauftragt Handwerker D mit Sanierungsarbeiten. Als vorsichtiger Kaufmann hat er sich vorher von D ein schriftliches Angebot erstellen lassen. Und dann kommt die Rechnung … H verschlägt es die Sprache: die Rechnung übersteigt die Angebotssumme um nahezu 50 %. H fragt, ob er das bezahlen muss?
Die Antwort ist komplex; sie richtet sich zunächst danach, ob H und D einen Werkvertrag nach BGB oder einen Bauvertrag unter Einbezug der VOB/Teil B abgeschlossen haben. Im ersten Fall gilt Werkvertragsrecht (§§ 631 ff BGB), im zweiten Fall zeigt sich ein Bauvertrag nach der VOB/B mit einzelnen Regelungen zur Abrechnung, Leistungsänderungen und Nachträgen. Abgrenzungsmerkmal: Ist die VOB/B nicht ausdrücklich vereinbart, gilt Werkvertragsrecht.
Und danach gilt: Unterbreitet der Handwerker ein Angebot (§§ 145 ff BGB), so handelt es sich um eine verbindliche Erklärung. Wird das Angebot durch den Auftraggeber - hier H - angenommen, kommt der Vertrag mit dem angebotenen Inhalt zustande.
- Wird ein Festpreis angeboten, so ist dies verbindlich. Der Handwerker ist dann an diesen angebotenen Festpreis gebunden; Ausnahme: Es werden ausdrücklich Zusatzleistungen beauftragt.
- Mit dem Angebot nicht zu verwechseln ist ein Kostenvoranschlag (§ 649 BGB). Hier werden die voraussichtlichen Kosten lediglich abgeschätzt. Eine Abweichung ist also zugelassen. Nur dann, wenn die tatsächlichen Kosten den Voranschlag wesentlich überschreiten, muss der Handwerker (Unternehmer) dem Besteller (Auftraggeber - Eigentümer) informieren (§ 649 Abs. 2 BGB). Der Besteller gewinnt dann ein Kündigungsrecht (§ 649 Abs. 1 BGB).
- Noch unverbindlicher als ein Kostenvoranschlag ist eine reine Kostenschätzung. Sie dient lediglich zur groben Orientierung des Auftraggebers. Zu einer rechtlichen Bindungswirkung kommt es in der Regel nicht. Anders formuliert: Gesetzlich nicht geregelt, vermittelt die Kostenschätzung nur eine unverbindliche Prognose. Sie vermittelt deshalb abgesehen vom Fall einer arglistig falschen Schätzung (§ 123 BGB) keinen Anspruch auf eine Preisbindung.
Zwischenfazit:
Als Auftraggeber benötigt man vor dem Abschluss des Vertrages mit dem Handwerker die klare Bestätigung dazu, ob ein Festpreis, ein unverbindlicher Kostenvoranschlag oder eine bloße Kostenschätzung bisher Verhandlungsgrundlage war.
Nun zur Abrechnungshöhe:
Für die tatsächliche Herstellung der Werkleistung erforderliche Maßnahmen und Materialien dürfen vom Handwerker auch abgerechnet werden. Es wurde aber bereits betont, dass den Handwerker eine Informationspflicht gegenüber dem Auftraggeber trifft, sobald die veranschlagten Kosten „erheblich“ überschritten werden. Nochmals: Nur so kann entschieden werden, ob der Vertrag komplett durchgezogen oder gekündigt werden soll.
Zeigt es sich, dass die Angebotspreise nicht gehalten werden können, so muss der Handwerker prüfen, ob es sich um eine wesentliche oder nur um eine unwesentliche Abweichung handelt. Kostensteigerungen in Höhe von ca. 15 - 20 % gegenüber dem Kostenvoranschlag muss der Kunde in der Rechnung hinnehmen. Liegt die Kostensteigerung darüber, muss informiert werden (§ 649 Abs. 2 BGB). Geschieht dies nicht, gewinnt der Auftraggeber ein Sonderkündigungsrecht sowie ein Schadensersatzanspruch (OLG Köln, Urteil vom 16.1.1998 - 19 U 98/97, juris). Als Voraussetzung eines Schadensersatzanspruchs muss der Immobilieneigentümer als Auftraggeber allerdings nachträglich beweisen, dass ein anderer Betrieb billiger gearbeitet hätte (OLG Celle, Urteil vom 4.3.2003 - 22 U 179/01, NJW-RR 2003, 1243).
Wer um eine Rechnung streiten muss, sollte versuchen, die örtliche Handwerkskammer um Schlichtung zu bitten. Häufig sind dort auch Schlichtungsstellen angesiedelt. Kommt es in diesen Fällen höherer Kostensteigerungen zum Vertragsrücktritt, muss der Kunde die bis zum Zeitpunkt der Kündigung mangelfrei erbrachten Leistungen gleichwohl bezahlen (§ 648 BGB).
Haus & Grund Mietverträge einfach online!
Aktuelle Versionen vom Wohnraummietvertrag, Gewerberaummietvertrag und Garagenmietvertrag einfach online erstellen und als PDF drucken.
Nun zum Bauvertrag nach VOB/Teil B;
Wird dieses Klauselwerk ausdrücklich in den Vertrag einbezogen, so knüpft es an die tatsächlich ausgeführten Leistungen an (§ 2 VOB/B). Abgerechnet wird dann nach Einheitspreisen und den tatsächlich erbrachten Mengen. Man könnte auch von Baumassen sprechen. Kommt es zur Abweichung ist wiederum nach einer prozentualen Marge zu differenzieren.
Beispiel:
Statt 100 m² Estrichboden werden 120 m² hergestellt. Der vereinbarte Einheitspreis bleibt unverändert, wenn sich eine Mehr- oder Minderleistung bis zu 10 % im Verhältnis zur kalkulierten Leistungsmenge ergeben (§ 2 Abs. 3 VOB/B). Im Falle von Abweichungen über 10 % können beide Vertragspartner eine Anpassung des Preises verlangen. Grundlage ist die ursprüngliche Kalkulation. Die Interessen beider Seiten sind angemessen zu berücksichtigen (BGH, Urteil vom 8.8.2019 - VII ZR 34/18, NJW 2020, 337).
Dieser im Verhältnis zum BGB unterschiedliche Ansatz führt zu folgender Bewertung: Die VOB/B regelt die Behandlung einer Kostensteigerung im Verhältnis zum abgegebenen Angebot sehr viel detaillierter als das Werkvertragsrecht im BGB. Zwar trägt der Eigentümer als Auftraggeber das Risiko einer Preiserhöhung von erhöhten Baumassen, erhält aber bei Abweichungen über 10 % einen Anspruch auf eine angemessene Preisneuberechnung.
Dagegen ist der Auftraggeber beim Werkvertrag nach BGB durch die Mitteilungspflicht geschützt. Der Vertrag bleibt aber unscharf in den Regelungen zulässiger Abweichungen und die daran geknüpfte Folge einer Preisänderung. Hier zeigt sich nur Richterrecht.
Insgesamt führt dieser Rechtsvergleich zu folgenden Empfehlungen:
- Klärung, ob ein Festpreis, ein Kostenvoranschlag oder eine Kostenschätzung Grundlage weiterer Verhandlungen ist; gegebenenfalls bestätigte Festpreise verlangen.
- Vor der Unterzeichnung die Vertragsunterlagen gründlich daraufhin prüfen, ob es sich um einen Werkvertrag nach BGB oder um einen Bauvertrag nach VOB/B handelt.
- Nochmals vor Unterzeichnung auch im Vertragswerk selbst klare Preisvereinbarungen treffen, idealerweise Festpreise zur Kostensicherheit.
- Leistungsverzeichnis als Vertragsbestandteil detailliert ausformen, um unklare Mengen und Nachträge zu vermeiden.
- Während der Ausführung des Vertrags ausreichend engen Austausch mit dem Handwerker einfordern; insbesondere bei absehbaren Mehrkosten sofortige Information und Aufklärung verlangen.
- Rechnungen auf tatsächlich beauftragte und auch ausgeführte Leistungen überprüfen; das kann sich durchaus lohnen. Denn so mancher Betrieb neigt dazu, eine angefangene halbe Stunde gleich als volle halbe Stunde abzurechnen. Dies aber ist unzulässig (LG Düsseldorf, Urteil vom 23.3 1988 - 12 O 292/87, VuR 1989, 37). Eine geringere Aufrundung wie zum Beispiel auf volle 5 Minuten ist aber in Ordnung. Pausen dürfen nicht als Arbeitszeit berechnet werden und auch nicht Wegezeiten, die anfallen, wenn der Handwerker ein Ersatzteil vergessen hat und extra deshalb zur Werkstatt oder zum Baumarkt fahren muss. Sind 2 Arbeitskräfte vor Ort, arbeitet aber nur ein Handwerker und der andere schaut zu, muss auch nur ein Handwerker bezahlt werden. Die Arbeitszeit kann dann nicht doppelt berechnet werden. Fahrtkosten sind nur auszugleichen, soweit sie tatsächlich entstanden sind.
- Am Bau Leistungsmängel oder Mangelfreiheit untersuchen und feststellen.
Schlussbemerkung:
Auf keinen Fall sollte ein Handwerker mit seinen Arbeiten beginnen dürfen, ohne dass der Kunde vorher die Kosten angesprochen hat. Und dies gilt auch, wenn es sich um eilige Sachen wie verstopfte Rohre oder ausgefallene Heizungen geht.
Notanker in diesem Fall: Wurde weder ein Kostenvoranschlag eingeholt noch eine Vereinbarung über die Vergütung getroffen, muss dennoch nicht jeder geforderte Betrag akzeptiert werden. Denn der Handwerker hat dann grundsätzlich nur einen Anspruch auf Zahlung der „üblichen“ Vergütung.
Rechtsanwalt Dr. Hans Reinold Horst, Hannover / Solingen