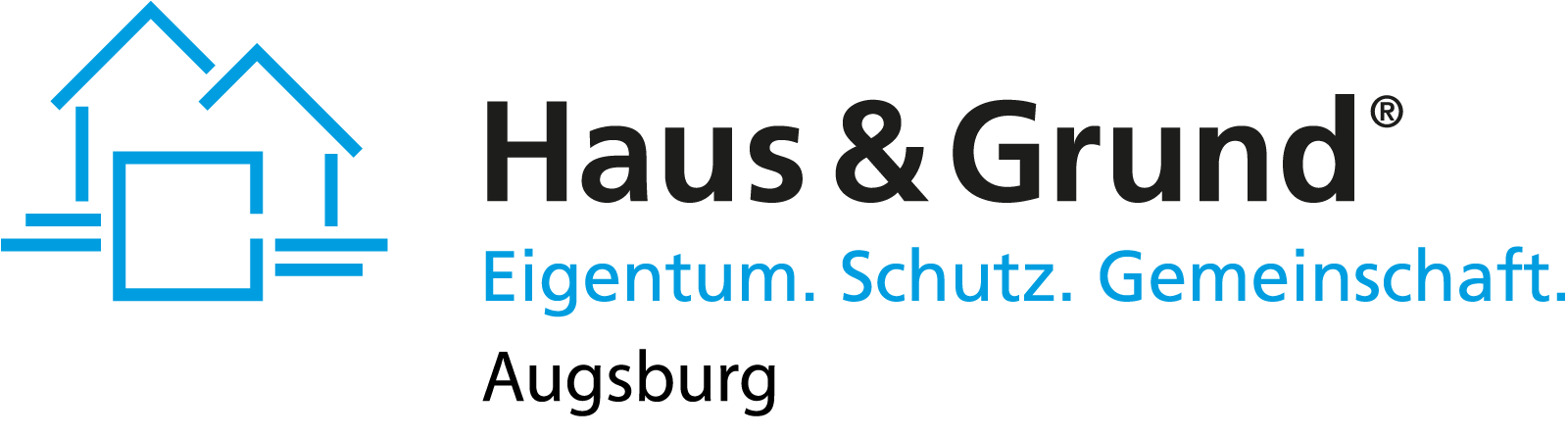


Nachbarrecht
Entschädigung fürs Laub fegen?
Besonders im Herbst gibt es für Immobilieneigentümer sehr viel Arbeit mit dem Laub der Nachbarbäume. Fallen die Blätter, wird Nachbars Laub bisweilen in großen Mengen auf das eigene Grundstück geweht - und natürlich auch in die Einfahrt, auf den Gehweg und die Straße davor. Geschieht das fast täglich und muss das Laub säckeweise aufgekehrt und „zum Grünschnitt“ transportiert werden, ist nachbarlicher Zwist geradezu vorprogrammiert.
Die konsternierte Frage: Warum soll ich Ihr Laub fegen? Weil es auf Ihrem Grundstück liegt! Die Antwort ist leider zutreffend. Denn als Grundeigentümer hat man im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht sein Grundstück möglichst von gefallenem Laub zu säubern, um Rutschgefahren und Stürze zu vermeiden. Kann man seinen Nachbarn dann wenigstens zur Kasse bitten, wenn man schon für ihn arbeitet?
Grundsatz: Kein Anspruch auf Entschädigung
Für das gefegte und entsorgte Laub des Nachbarn kann man nur dann eine Entschädigung, genannt „Laubrente“ verlangen, wenn mit den Arbeiten eine unzumutbare Belastung einhergeht. Das gilt nicht nur für die Beseitigung von Nachbars Laub, sondern auch für Nadeln, Tannenzapfen, Fallobst, Samen und Blüten. Denn: Laubfall gilt als „natürliche ortsübliche Einwirkung“ (BGH, Urteil vom 14.11.2003 - V ZR 102/03, BGHZ 157, 33 ff; BayObLG, Urteil vom 16.12.1991 - RReg 1 Z 428/90, zit. nach juris; LG Krefeld, Urteil vom 20. April 2018 - 1 S 68/17, MDR 2018, 989; AG München, Urteil vom 26. Februar 2013 -114 C 31118/12, IMR 2014, S. 36; OLG Frankfurt, Urteil vom 16.8.2024 - 19 U 67/23, juris).
Ausnahmen: Jetzt gibt es Geld!
1. Unzumutbarkeit
Die erste Ausnahme mit der Folge eines Anspruchs auf Laubrente besteht, wenn ohne diese Rente die vermehrt anfallenden Kehr- und Entsorgungsarbeiten unzumutbar werden. Was man eine unter einer unzumutbaren Belastung versteht, wird im Folgenden erörtert. Dazu lohnt zunächst ein Blick in § 906 Abs. 2 BGB. Danach kann eine Entschädigung („Laubrente“) verlangt werden, wenn das Maß des Zumutbaren durch eine wesentliche und ortsunübliche Beeinträchtigung überschritten wird. Natürlich muss das im Einzelfall geprüft werden (BGH, Urteil vom 27. 10. 2017 - V ZR 8/17, juris insbesondere Rn. 19, 20; BGH, Urteil vom 14.11.2003 - V ZR 102/03, BGHZ 157, 33, 42 f):
- Ortsübliche Menge: Liegt das betroffene Grundstück in einem ländlichen oder städtischen Gebiet, und welche „Durchgrünung“ liegt im Wohnquartier vor? Entscheidend ist das vorliegende Gesamtgepräge des Viertels (OLG Frankfurt, Urteil vom 16.8.2024 - 19 U 67/23, IMR 2025, 32 = ZMR 2025, 654; Bau eines Swimmingpools im Traufbereich zweier 92 Jahre alter Eichen; Zumutbarkeit erhöhten Reinigungsaufwandes bei älterem und höherem Baumbestand als prägende Quartierseigenschaft – Laub im Pool ist ortsüblich und zumutbar).
- Anteil des fremden Laufs zum eigenen Laub: In welchem Verhältnis steht der zusätzliche Reinigungsaufwand für Nachbars Laub zu dem Aufwand, die für die Reinigung des eigenen Grundstücks von Laub und ähnlichem sowieso zu betreiben ist?
- Maß der Beeinträchtigung: Werden zum Beispiel mit der Notwendigkeit von Folgearbeiten und einem dafür zu tragenden Kostenaufwand Dachrinnen verstopft? Werden Gartenanlagen in ihrer Funktion beeinträchtigt? Kommt es zum großflächigen Abwurf von Fallobst in großen Mengen mit der Folge eines Insektenbefalls des betroffenen Grundstücks?
- Verstärkter Reinigungsaufwand: Muss ein erheblicher und auch zeitlich gesteigerter Aufwand bei der Beseitigung des Laubs betrieben werden, der Kosten verursacht? Lässt sich die Reinigung nur durch den Einsatz von Arbeitsmaschinen bewältigen? Wie viel Zeit und Kosten fallen für die Entsorgung einschließlich des Transports an?
In seinem Urteil vom 27.10.2017 - V ZR 8/17 juris betont der BGH, der Ausgleichsanspruch gemäß § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB knüpfe an die Verantwortlichkeit des Baumeigentümers für den Laubabwurf seiner Bäume und die damit einhergehende unmittelbare Beeinträchtigung des Nachbarn an (Entscheidungsgründe Rn. 18). Von der Verantwortlichkeit geht der BGH aus, wenn die Bäume den landesrechtlichen Bestimmungen zuwider den Grenzabstand verletzen und sich deshalb die Nutzung des störenden Grundstücks nicht mehr im Rahmen ordnungsgemäßer Bewirtschaftung hält. Nach § 906 Abs. 1 BGB komme es darauf an, ob sich der Laubabwurf als „wesentliche Beeinträchtigung“ darstelle. Davon sei auszugehen, wenn nach dem Klägervortrag das von den Bäumen des beklagten Nachbarn abfallende Laub dazu führe, dass die Dachrinne und die Abläufe an ihrem Haus häufiger als es sonst nötig wäre gereinigt werden müssten (BGH, aaO, Rn. 19 der Entscheidungsgründe; ebenso: BGH, Urteil vom 14.11.2003 - V ZR 102/3, BGHZ 157, 33, 42 f). In dem vom BGH entschiedenen Fall wurde zurückverwiesen, um diesen Umstand noch tatrichterlich aufzuklären.
Ebenso war noch aufzuklären, ob durch den Laubabwurf Nachteile für den beeinträchtigten Grundstückseigentümer entstehen, die das zumutbare Maß einer entschädigungslos hinzunehmenden Beeinträchtigung übersteigen. Denn diese Feststellung sei für die Zuerkennung einer Entschädigung nach dem nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch von Bedeutung, wie der BGH hervorhebt. Insoweit komme es darauf an, in welchem Verhältnis der von dem beeinträchtigten Grundstückseigentümer behauptete zusätzliche Reinigungsaufwand zu dem Aufwand stehe, den er für die Reinigung seines Grundstücks von Laub und Ähnlichem sowieso habe (BGH, aaO, Rn. 20 der Entscheidungsgründe). Der erhöhte Reinigungsaufwand, hervorgerufen durch die Immissionswirkung der Nachbarbäume, müsse also das normale Maß übersteigen. Um dies zu klären bedürfe es noch einer Beweisaufnahme.
Und schließlich: Ein nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch analog § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB sei ausgeschlossen, falls es das Naturschutzrecht untersage, eine Einwirkung auf das Grundstück des Gestörten zu unterlassen oder abzustellen. Anderenfalls hätte der Baumeigentümer und Störer eine Entschädigung für die Folgen einer gesetzlichen Regelung zu zahlen, die der Gesetzgeber nicht im Interesse des Störers, sondern im allgemeinen Interesse für notwendig hält (BGH, aaO., Rn. 21 und 22 der Entscheidungsgründe; ebenso BGH, Urteil vom 20.11.1992 - V ZR 82/91, BGHZ 120, 239, 252). Auch in diesem Punkt sieht der BGH noch tatrichterlichen Aufklärungsbedarf. Denn der beklagte Baumeigentümer habe nach den Ausführungen des Berufungsurteils substantiiert dargelegt, dass die für eine Fällung der Bäume erforderliche Genehmigung von der Stadt X nicht erteilt werde.
Um einmal den Maßstab, besser gesagt - die „Hürde“ für einen zuerkannten Entschädigungsanspruch - zu zeigen:
Keine Entschädigung wird in einem Fall zugesprochen, in dem das Grundstück mit Zierrasen in Form eines englischen Gartens gestaltet sei und alles im Herbst. bis zu einer Höhe von 10 cm mit Laub der nachbarlichen Lindenbäume bedeckt war; jährlich mussten 10 bis 15 80 l Tonnen vollgestopft mit Laub entsorgen werden die Dachrinne musste viermal jährlich gereinigt werden (AG München, Urteil vom 26. Februar 2013 -114 C 31118/12, IMR 2014, S. 36).
Auch das OLG Hamm (Urteil vom 1. Dezember 2008 – 5 U 161/08, NZM 2009, Seite 335) versagt eine finanzielle Entschädigung für das ständige Laub fegen. Zwar gehöre Laubabfall sowie das Abfallen von Bucheckern und Blüten auf ein Nachbargrundstück zu den „ähnlichen Einwirkungen“, die im Falle ihrer Duldungspflicht zu einer Entschädigung auf der Grundlage eines nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruchs aus § 906 Abs. 1 Satz 1 BGB berechtigen könnten. Geld gebe es aber nicht, wenn die Bäume durch eine örtliche Baumschutzsatzung ansich bereits geschützt seien. Die Baumschutzsatzung stehe nur dann nicht entgegen, wenn das Anpflanzen der Bäume als rechtswidrig anzusehen wäre, eine Ausnahmegenehmigung für die Beseitigung der Laubbäume beantragt werden könnte oder die Erteilung dieser Ausnahmegenehmigung daran scheitere, dass eine Beseitigung der Bäume jetzt dem Zweck der Baumschutzsatzung widerspreche, weil der Baumeigentümer bisher pflichtwidrig das ungehinderte Wachstum der Bäume hingenommen habe. Aber auch wenn eine Baumschutzsatzung nicht bestehe, sei Laubfall in aller Regel als Natureinwirkung hinzunehmen, solange er ortsüblich und nicht von extrem hohen Ausmaßen sei und den Eigentümer des Nachbargrundstücks deshalb nicht „wesentlich“ beeinträchtige.
Gegen eine solche wesentliche Beeinträchtigung spreche nach Auffassung der OLG-Richter auch, dass es sich um jahreszeitlich bedingte und beschränkte Einwirkungen handele, für deren Beseitigung „ein relativ geringer Zeit- und Arbeitsaufwand“ erforderlich sei (im Ergebnis ebenso bereits: BGH, Urteil vom 14.11.2003 - V ZR 102/03 - NJW 2004, Seite 1037; OLG Karlsruhe, Urteile vom 09.09.2009 - 6 U 185/07, DWW 2010, 59 und vom 09.11.1988 – 6 U 100/88, AgrarR 1990, S. 209). Eine andere Bewertung könne nur angezeigt sein, wenn die Einwirkungen der Bäume bereits objektiv feststellbare physische Auswirkungen auf das Eigentum des Klägers hätten (ebenso: BGH, Urteil vom 14.11.2003 - V ZR 102/03 - NJW 2004, Seite 1037). Dies aber müsse der Laub fegende Eigentümer als Geschädigter vortragen und nachweisen.
Haus & Grund Mietverträge einfach online!
Aktuelle Versionen vom Wohnraummietvertrag, Gewerberaummietvertrag
und Garagenmietvertrag einfach online erstellen und als PDF drucken.
2. Verletzter Grenzabstand ohne Rügemöglichkeit
Die zweite Ausnahme greift, wenn die Bäume auf dem Nachbargrundstück den vorgeschriebenen Grenzabstand nicht einhalten, gleichwohl aber ihre Beseitigung wegen Ablaufs der dafür im Landesnachbarrecht vorgesehenen Ausschlussfrist nicht mehr verlangt werden kann. In diesem Fall kann ein nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch in Betracht kommen (§ 906 Abs. 2 Satz 2 BGB analog). wie der BGH mit Urteil vom 27. 10. 2017 - V ZR 8/17 juris; entscheidet (vgl. ebenso bereits BGH, Urteil vom 14.11.2003 - V ZR 102/03, BGHZ 157, 33). Natürlich ist auch dann eine nachgewiesene Beeinträchtigung des betroffenen Grundstücks notwendig (hier eine ständig verstopfte Dachrinne). Wie kommt der BGH zu diesem Urteilsspruch?
Geklagt hatte ein Nachbar gegen den anderen Eigentümer des angrenzenden Grundstücks. Auf diesem Grundstück stehen unmittelbar an der Grenze verschiedene hoch gewachsene Bäume. Dazu behauptet der Nachbar, die Bäume verschatteten das Grundstück, bewirkten starken Laubfall, überzögen das eigene Haus mit Moos und beeinträchtigten auch die gärtnerische Nutzung des eigenen Grundstücks erheblich. Deshalb klagte der Nachbar und beantragte Verurteilung auf
- die Entfernung der näher bezeichneten Bäume, hilfsweise auf
- die Entfernung des Überhangs an der Flurstücksgrenze und die Kürzung der Bäume in der Höhe auf 3 m, ferner
- den Ersatz vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten nebst Zinsen, hilfsweise
- Verurteilung des Baumeigentümers zur Zahlung als Ersatz des finanziellen Aufwands im Jahr, der sich aus Kosten für den jährlich anfallenden erhöhten Reinigungsbedarf des eigenen Anwesens sowie aus jährlichen Mehraufwendungen zusammensetzt, die deshalb entstünden, weil es wegen der Verschattung eines Grundstücks teils nicht möglich sei, dort Obst und Gemüse anzubauen, hilfsweise darauf
- festzustellen, dass der Baumeigentümer als Beklagter verpflichtet sei, dem Kläger jährlich die Aufwendungen für den verschattungsbedingt erhöhten Aufwand zur Säuberung des Grundstücks und Gebäudes und den Ankauf von Obst und Gemüse zu erstatten.
Im Ergebnis erkennt der BGH die geltend gemachten Ansprüche nur teilweise zu und verweist zur endgültigen Entscheidung an die Berufungsinstanz zurück. Die Begründung: Die Entfernung oder die Kürzung der Bäume könnten nicht verlangt werden, weil die Ausschlussfrist zur Geltendmachung entsprechender Abwehr-, Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche nach dem Landesnachbarrecht abgelaufen sei (vgl. auch BGH, Urteil vom 14.11.2003 - 5 ZR 102/03, BGHZ 157,33, 45 zu § 54 Abs. 2 Nds. NRG). Auch das Höhenwachstum der Bäume sei deshalb zu dulden (vgl. § 54 Abs. 2 Satz 2 Nds. NRG für die abweichende Rechtslage in Niedersachsen).Die Ausschlussfrist umfasse von ihrer Zweckrichtung her allerdings keine Entschädigungsansprüche wegen der zu duldenden Hinnahme von Immissionen. Sie seien also zu untersuchen.
Grundsätzlich gelte dafür: Wer durch Laubfall von Bäumen des Nachbarn, die den Grenzabstand einhalten, wesentlich beeinträchtigt werde, könne danach unter Umständen einen Geldausgleich verlangen, obwohl er keinen Anspruch auf Beseitigung der Bäume habe (BGH, aaO., Rn. 12 der Entscheidungsgründe). Dann aber gelte dies erst recht bei verletzten Grenzabständen. Denn auch dann sei der Nachbar aus Rechtsgründen gehindert, den ihm eigentlich zustehenden Anspruch auf Beseitigung der Störung seines Eigentums durch Laubfall und ähnliches gemäß § 1004 Abs. 1 BGB geltend zu machen. Diese Duldung solle nach der Wertung des § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB nicht entschädigungslos erfolgen und rechtfertige eine entsprechende Anwendung der Vorschrift (BGH, aaO. Rn. 12 der Entscheidungsgründe am Ende).
Diese Einschätzung, die der BGH für den Fall von Laub und sonstigen Baumbestandteilen artikuliert, erstreckt er nicht auf die Verschattung des Grundstücks oder des Hauses.
Denn das Abfallen von Laub, Nadeln, Blüten und Zapfen von Sträuchern und Bäumen gehöre zu den „ähnlichen Einwirkungen“ im Sinne des § 906 Abs. 1 Satz 1 BGB (ebenso: BGH, Urteil vom 14.11.2003 - V ZR 102/03, BGHZ 157, 33, 45); der Entzug von Luft und Licht durch Anpflanzungen auf dem Nachbargrundstück stelle aber keine derartige Einwirkung dar (ebenso auch: BGH, Urteil vom 10.7.2015 - V ZR 229/14, NJW-RR 2015, 1425 Rn. 15 mwN). Solche „negativen Einwirkungen“ habe der Nachbar auch unter Berücksichtigung der Pflichten aus dem nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnis grundsätzlich hinzunehmen. Deshalb seien solche Beeinträchtigungen rechtmäßig und Abwehr-, Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche demzufolge nicht zu diskutieren. Dann aber scheide auch ein nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch, gerichtet auf eine Geldentschädigung, aus (§ 906 Abs. 2 Satz 2 BGB analog).
Mit derselben Argumentation seien auch Mehraufwendungen für den Ankauf von Obst und Gemüse, das wegen der Verschattung nicht selbst als Ertrag aus dem Grundstück gewonnen werden könnte, nicht begründet. Dasselbe gilt nach der Ansicht des BGH schließlich für die geltend gemachten Reinigungskosten, die zur Beseitigung der verschattungsbedingten Moosbildung auf dem Hausdach angefallen sind. In der Sache verwies der BGH wegen eines weiteren Aufklärungsbedarfs an die Berufungsinstanz zurück.
Der Sonderfall Laubrente von der Kommune
Sollten die dargelegten Voraussetzungen für den Erhalt einer Entschädigung (Laubrente) erfüllt sein, können sich Städte und Gemeinden an den Reinigungskosten beteiligen. Allerdings müssen Sie das nicht. Denn kommunale Satzungen können derartige Aufwendungsersatzansprüche einschränken, indem sie regeln, wer für die Reinigung bestimmter Flächen verantwortlich ist. So können zum Beispiel Gemeinden für Gehwege vor dem eigenen Grundstück die Reinigungs- und Kehrpflicht auf dem Grundstücksanlieger übertragen. Folge ist dann, dass Entschädigungsansprüche ausgeschlossen sind. Der Bürger muss also zum Besen greifen, auch wenn das Laub auf dem Gehweg von Bäumen im Eigentum der Gemeinde stammt.
Dadurch dürfen die betroffenen Bürger aber nicht übermäßig belastet werden, wie das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) mit (Urteil vom 12.02.2007 - 12 KN 399/05, DWW 2008, S. 66) betont. In dem entschiedenen Fall musste eine niedersächsische Gemeinde ihre Anordnung zum Straßenkehren und zum Laub fegen in einem Bereich zurücknehmen, in dem sich auf etwa 25 Meter Wegstrecke 40 alte Rosskastanien befinden, die im Frühjahr Unmengen von Blütenabfall und im Herbst noch größere Mengen von Laub produzieren. Für deren Beseitigung sei ein „Maschinenpark“ erforderlich, den Privatleute nicht anschaffen müssen, so die Verwaltungsrichter aus Lüneburg. Zusätzlich stellten sie fest, dass bei täglich mehr als 1.200 Autos, die die Straße befahren, die Reinigung mit erheblichen Gefahren verbunden sei. Dies alles mache die Heranziehung privater Grundstücksanleger zum Laubfegen rechtswidrig.
Das ist aber die Ausnahme. Denn grundsätzlich muss der Bürger gefallenes Laub beseitigen, auch wenn das Laub auf dem Gehweg von Straßenbäumen der Gemeinde stammt. Entsprechende Festlegungen in Straßenreinigungssatzungen sind üblich. So hat das Verwaltungsgericht Lüneburg am 13.02.2008 (Az.: 5 A 34/07 – zitiert nach juris) entschieden, die Gemeinde könne für ihre eigenen Straßenbäume den Anliegern der Straßen die Straßenreinigungspflicht übertragen. Sie seien zum Fegen des Laubes verpflichtet, wenn die Bäume auf öffentlichem Grund direkt neben den eigenen Grundstücken stehen.
Auch von Bäumen auf öffentlichem Straßengrund herabfallendes und in die eigenen Grundstücksbereiche herüberwehendes Laub kann nicht abgewehrt werden, wenn aus einem örtlich geltenden Bebauungsplan ein entsprechendes Pflanzgebot im Hinblick auf die „immissionierenden“ Bäume folgt (VG Ansbach, Urteil vom 29. November 2017 - AN 9 K 16. 01056, juris).
Tipp: Rückschnitt verlangen
Auch wenn in aller Regel keine finanzielle Entschädigung für das Laub fegen verlangt werden kann, so können die Bäume des Nachbarn doch den Eigentümer eines Grundstücks wesentlich beeinträchtigen und damit zu einem Anspruch auf Rückschnitt führen, wenn ihre Äste über die Grenze auf oder über das eigene Grundstück ragen und zum Beispiel die Dachrinne des eigenen Hauses ständig mit Laub verstopfen (AG Kerpen, Urteil vom 12. April 2011 – 110 C 140/10, NZM 2012, Seite 583).
Neben der Straßenreinigungssatzung oder aus Festsetzungen in Bebauungsplänen kann sich diese Folge auch auf einer Baumschutzsatzung ergeben. Denn wenn Aspekte des Naturschutzes greifen, können damit einhergehende Einwirkungen ebenso nach § 906 Abs. 2 BGB zu dulden sein. Die Folge ein nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch analog § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB ist dann ausgeschlossen (BGH, Urteil vom 27. 10. 2017 - V ZR 8/17 juris, Rn. 21 und 22 der Entscheidungsgründe; OLG Frankfurt, Urteil vom 16. August 2024 – 19 U 67/23 –, juris, Rn. 62 der Entscheidungsgründe).
Rechtsanwalt Dr. Hans Reinold Horst, Hannover / Solingen